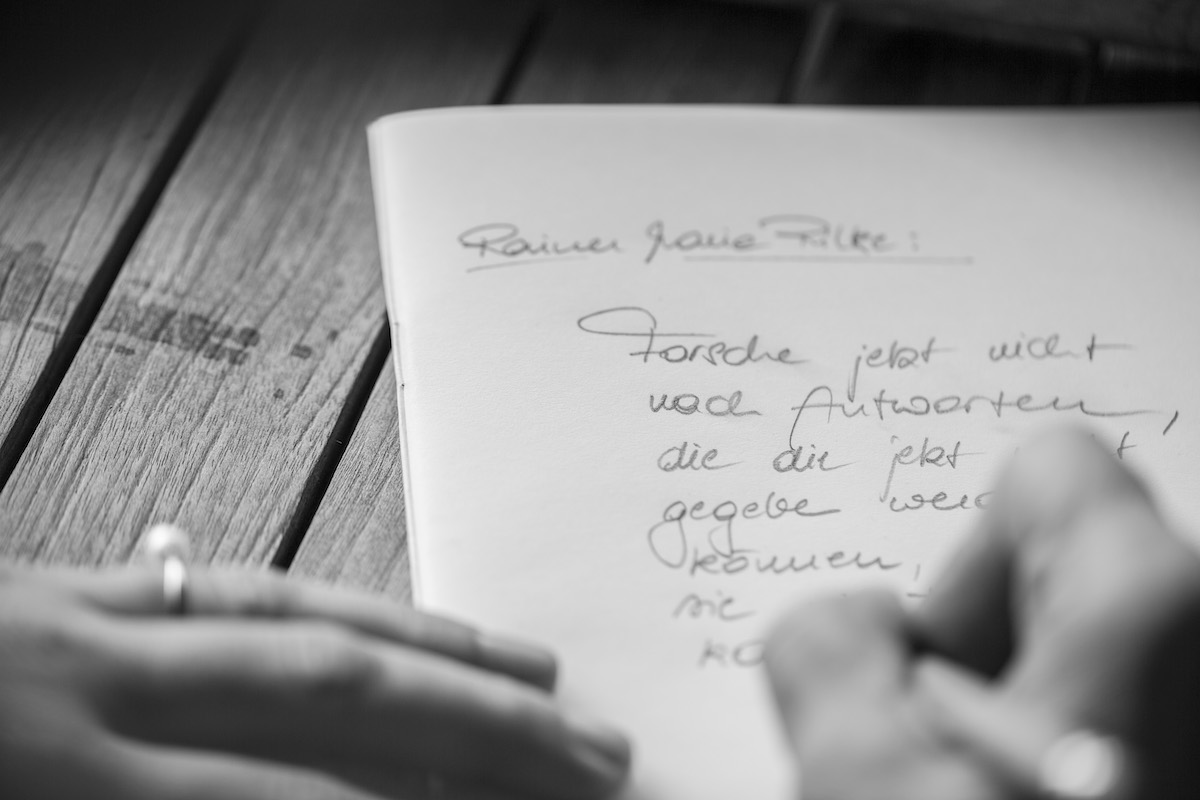Leben auf Sicht – etwas anderes ist derzeit nicht möglich. Wie sich von heut‘ auf morgen Meinung und Verhalten ändern können, was eine schulische Zwangspause für eine Familie bedeutet und welche Gedankensprünge einem in verlangsamten Zeiten wie diesen auf Trab halten ...
Ende Februar lässt uns die zwischen Ländle und Lombardei pendelnde Cellolehrerin meiner Tochter wissen, die hiesige Musikschule habe aus Angst vor einer Corona-Ansteckung fürs Erste ihren Unterricht abgesagt. Ich finde dies, gelinde gesagt, ziemlich übertrieben. Nur eine Woche später, die Situation in Oberitalien wird immer verheerender, schleicht sich leise in mir ein Sinneswandel an. Wie war das nochmals mit der Sterblichkeitsrate? Und wer genau zählt zur Risikogruppe? Meine 15-jährige Tochter schaut irritiert. Ob ich jetzt etwa auch Panik schiebe? „Nein, eh nicht“, sag ich, „ich mein‘ ja nur.“, google ein bisschen und gehe später auf eine größere Veranstaltung. Wir schreiben inzwischen den 6. März. Meine Begleitung sagt mir kurzfristig ab. Ihr Partner müsse in Quarantäne, weil der Chef das Virus habe. Sie wolle nicht riskieren, jemanden anzustecken, falls ... Also doch schon so nah. Dennoch umarme ich weiterhin unbekümmert Menschen. Als mir nur wenige Tage später zwei Personen entschieden den Händedruck zur Begrüßung verweigern, bin ich es, die irritiert schaut. Bin ich naiv oder sind sie überängstlich? Meinen Eltern, die auf Teneriffa sind, schreibe ich, sie sollen sich überlegen zu verlängern, hier werde es ungemütlich. Und revidiere nur 48 Stunden später: Ich finde, sie sollten schleunigst nach Hause kommen. Noch in derselben Woche spreche ich mich bei einem Meeting für eine Begrüßung ohne Handschlag aus. Komisch ist das. Lächerlich finde ich es eigentlich nicht mehr. Bin ich gehirngewaschen oder nur vernünftig? Ich weiß nicht, was ich von der ganzen Sache halten soll. Alles fängt an anders zu werden.
Freitag, der 13.
Statt Klopapier zu kaufen entscheide ich mich für Gelassenheit und gehe ins Yoga. Nicht ohne mir die Frage zu stellen, ob das noch angebracht ist. Die Ein-Meter-Abstandsregel wird hier jedenfalls bereits intuitiv eingehalten. Zuhause am Mittagstisch entfacht sich eine Diskussion: Darf die Jugend am Abend noch ausgehen? Ich argumentiere mit schwerem Geschütz, höre mich plötzlich Worte sagen wie „Krisensituation“ und „Solidarität“. Meine Tochter findet es sehr solidarisch, ihre Freunde zu treffen. Ich werfe ihr vor, die Freunde wichtiger zu nehmen als die Familie, „gerade jetzt in diesem gesellschaftlichen Ausnahmezustand.“ Mein Mann straft mich mit Blicken und meint, ich solle mich bitte an meine Jugendzeit erinnern. Also gut. Verstimmt bin ich trotzdem. Ein Tag später, am Samstag, ist bereits allen die Ausgeh-Lust vergangen. Und am Sonntag, die Ausgangssperre ist beschlossen, hat sich die Welt verändert. Meine Freundin schreibt mir: „So schnell kann es gehen. Eine Bremse, eine Rückbesinnung. Mit Angst leider.“ Und ich werde mich die nächsten Wochen immer wieder fragen: Habe ich Vertrauen in die Regierung? Sind die geplanten Restriktionen angemessen? In welcher Relation stehen unsere Freiheitsrechte zur unsichtbaren aber bereits andernorts Katastrophenzustände erzeugenden Bedrohung? Wehe dem jedenfalls, der mir jetzt mit dem Hausverstand kommt. Denn der spuckt in den Kategorien „Pandemie“ und „Corona“ rein gar nichts aus. Was sind Quellen für seriöse Information? Wo bleibt meine Selbstermächtigung? Beim siebenstellig geteilten „Alles-halb-so-wild“-Video eines Arztes komme ich kurz ins Zweifeln, ob wir nicht doch einer Hysterie aufsitzen. Am Abend rückt die ZIB mit den Bildern aus Italien wieder in den Fokus, worum es geht: Menschen vor dem Tod zu schützen, das Gesundheitssystem nicht zum Kollabieren zu bringen. Gut, ich bin dabei, ich stelle mich auf Häuslichkeit ein. Aber das ist im Grunde schon längst nicht mehr meine Entscheidung. Die Regierung hat übernommen. Und mein Jüngster wunde Handrücken vom vielen Händewaschen.
Die schulische Zwangspause beginnt
Meine 15jährige Tochter arbeitet komplett selbstständig. Sie ist in digitaler Dauer-Konferenz mit ihrer Klasse. Abgeschottet im Dachboden genießt sie die freie Zeiteinteilung. Blicken lässt sie sich meist nur zum Essen und dann klingt es manchmal, als würde sie soeben von der Schule heimkommen - wenn sie sich beispielsweise aufregt, trotz eigentlich schulfreiem Josefitag mit Aufgaben geflutet worden zu sein. Meine zwei Jungs sind in Woche eins auch noch topmotiviert. Das heißt aber nicht, dass sie leise arbeiten. Jede Aufgabe wird rauf und runter kommentiert – inklusive aller Unmutsbekundungen und Gedankengänge. Ich gehöre der Berufskategorie der Selbstständigen an, ein Schwerpunkt ist das Schreiben. Dafür braucht es vor allem eines: Ruhe. Ich war immer schon im Homeoffice tätig. Aber halt alleine. Nun kann ich keinen Satz mehr am Stück denken, geschweige denn schreiben. Natürlich fehlt mir das Alleinsein – welche Ambivalenz in Zeiten der Isolation. Aber alles kein Grund zum Jammern. Solange ich Sätze schreiben darf, bin ich wohl eine jener Privilegierten, die ihren Job noch machen dürfen. Eine Freundin ruft an und erzählt mir, sie und ihr Mann, beide Künstler, hätten für mindestens zwei Monate keine Aufträge mehr. Sprich: keine Einkünfte. Ich bin bestürzt. Wie soll das gehen?
Böser Bär, gutes Medium
Glück ist, ein Zuhause zu haben. Die Sonne scheint und kitzelt trotz der vielen Verbote ein Gefühl von Freiheit hervor. Die Jungs spielen viel draußen. Die Nachbargärten sind tabu – Ü 60-Zone und sowieso. Mein Jüngster schreibt Mitte Woche eine Geschichte über drei Datteln, die sich mit drei Nüssen auf den Weg machen. Der böse Bär steckt einen von ihnen mit Corona an. Die anderen fünf beten, dass er innerhalb einer Minute vom Virus befreit wird. Es klappt. Fast zeitgleich an meinem Handy ein Aufruf über WhatsApp zu einer Gemeinschaftsmeditation mit dem Medium „Christina von Dreien“: Eine Million TeilnehmerInnen werden gesucht, um das Coronavirus zu stoppen ... Weniger optimistisch aber vermutlich realistischer verlängert die Regierung die Ausgangssperre. Der Gesundheitsminister hat etwas Beruhigendes (Kurzes Gedankenspiel: Wie es wohl wäre, wenn noch Hartinger-Klein das Amt ausführen würde?), der Innenminister (noch schaurigeres Gedankenspiel „Kickl“) mit seinem streckenweise militärischen Sprech hingegen macht mich nervös. Wiewohl ich verstehe und befürworte, dass die Regelungen durchgezogen werden müssen. Bis nach Ostern also noch. Ich für meinen Teil bin bereits nach Woche eins erschöpft. Allen Terminstreichungen und Krise-als-Chancen-Geboten zum Trotz: Viel Innehalten war da nicht. Entschleunigter denn je ist bei mir lediglich der Haushalt. Das Putzen auf später zu verschieben, das beherrschte ich allerdings davor auch schon. Ich wundere mich, wie schnell diese Tage vergehen, wie müde ich jeden Abend bin und frage mich, ob meine Aufträge zu halten sind? Die Wirtschaft geht den Bach runter. Mein Vorstellungsvermögen ist überfordert: Ein 38 Milliarden schwerer Rettungsschirm. Über 97.000 Arbeitslosen-Meldungen mehr in nur einer Woche. Die Gefahr der Zunahme häuslicher Gewalt ... Nichts wird so bleiben, wie es war. Das Wetter schlägt auch um.
Emotionale Achterbahn
Wochenende. Ich entscheide mich, eine Runde joggen zu gehen. Und merke, dort, durch das Gestrüpp, so mausgagelalleine in aller Herrgottsfrüh: Ich habe Angst. Aber nicht vor dem Virus, sondern vor der Spezies Mensch. Man weiß ja nie, wer aus dem nächsten Busch springt. Ich wechsle die Laufstrecke. Erschöpft kuschle ich mich zu Hause in eine Decke ein. Die Buben gesellen sich zu mir. Der erste fragt: „Bist du krank?“ Der zweite: „Hast du Husten?“ Sie halten mir den Fiebermesser ins Ohr. Der liegt seit Tagen griffbereit herum. Auch so ein Phänomen: Wer kann schon noch im – selbst nebengeräuschfreien - Brustton der Überzeugung sagen, dass er das Virus nicht hat? Humorvolles und Hoffnungsfrohes trudelt via WhatsApp ein. Der Wandel wird als Rettung fürs Klima und die Menschheit beschworen. Gerne möchte ich das glauben, liebe den Gedanken an Delfine in Häfen, will keine Spielverderberin sein und schicke Daumen hoch und Herzen zum Dank. Bei allen aufmunternden Solidaritätsbekundungen melden sich aber auch leise Zweifel in mir, weil: Die Grenzen sind dicht, die Fürsorge konzentriert sich stark aufs Nationale. Wovon ist das der Anfang? Was passiert eigentlich gerade mit der europäischen Idee? Was, wenn der viel beschworene Zusammenhalt einem Patriotismus frönt, der über Heimatverbundenheit und Stärkung lokaler Produzenten hinaus vor allem nationalistische Tendenzen stärkt? Und denkt überhaupt noch jemand an die Zustände in den türkischen Flüchtlingslagern und an der griechischen Grenze? Ich will mir nicht vorstellen, was passiert, wenn dort das Virus grassiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nicht tun wird.
Die Wand
Am Sonntag Familienausflug in die Natur. Am Parkplatz treffen wir – zufällig natürlich – eine befreundete Familie. Zusammen zählen wir verdächtige 11 Leute. Wir tauschen uns kurz unter Einhaltung von mindestens drei Metern Sicherheitsabstand aus. Normalerweise hätte man spätestens an dieser Stelle alle Pläne durchbrochen und wäre auf einen gemeinsamen Kaffee gegangen. Diesmal wünscht man sich das mehr als rhetorisch Gemeinte „Gesund bleiben“ und geht schnell wieder getrennte Wege. Wege, die im Erholungsgebiet Alter Rhein üblicherweise im wahrsten Sinne des Wortes grenzüberschreitend sind. Doch wo Grenze draufsteht ist ab sofort auch Grenze gemeint. Mehrfach stehen wir vor Absperrungen, der Rundweg funktioniert nicht mehr. Ich muss kurz an Marlen Haushofers „Die Wand“ denken.
Woche zwei
Ha. Ich wusste es. An mir ist wirklich keine Pädagogin verloren gegangen. Gäbe es eine WM in der Disziplin Hausunterricht, ich würde nicht mal die Quali schaffen. Schon eher müsste man meinen Kinder Tapferkeitsmedaillen verleihen. Das Grundproblem: Ich werde ungeduldig, wenn nicht verstanden wird, was ich erkläre und muss so tun, als sei ich die Ruhe selbst. Das ist wie in eine Zitrone zu beißen und ein Gesicht zu machen, als wäre es Erdbeereis. Beherzt biete ich mich dennoch zum Rechnen-Üben an. Ein Aufschrei der Jungs. Bloß nicht. Sie fürchten um die gute Stimmung. Sie würden lieber auf den Papa warten. Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Es gibt Phasen am Tag, da reden sie ohne Punkt und Komma, die Buben. Jeder noch so unwichtige, nicht fertig gedachte Gedankengang wird zur Diskussion freigegeben. Meine Aufträge dümpeln dahin. Ich komme zu nichts. Dafür aber auf Ideen: Wir könnten Fotos anschau‘n! Die Bilder wecken Erinnerungen. Zum Beispiel an die Moirs, eine Familie, die wir in Neuseeland kennen gelernt haben. Ihre sechs Kinder wurden „homegeschoolt“, ich fand das bemerkenswert. Bei aller Hochachtung führt mir die neue Heim-Belagerung vor Augen, wie sehr mich Schule eigentlich entlastet. Systemkritik hin oder her. Heimlich stimme ich ein Loblied auf Maria Theresia an. Und glaube inzwischen nicht mehr, dass nach Ostern mein Homeoffice wieder mir gehört.
Shutdown
Zwischen Zeitwörter-Quiz und Rechtschreib-Lektionen checke ich an der viralen Front die Lage in Vorarlberg. Dieselbe Nachricht seit Anfang der Krise: Die Zahl der Infizierten steigt, die Betten auf der Intensiv sind vorbereitet. Ja, tief drin in mir bin ich dankbar, dass der Mensch, der Wert der Gesundheit, über das Kapitalistische gestellt wird. Und dass Österreich schnell und nicht im Lauwarm-Modus gehandelt hat. Auch nicht lau, vielmehr heiß-kalt ist mein persönliches Erleben dieser wandelnden Zeit. Dafür genügt ein Blick in den Posteingang: Da eine Ode an die neue Langsamkeit, dort ein Horx’scher Blick in die Glaskugel, hier ein Schreckensszenario Zukunft. Von einem Freund wird mir ein NZZ-Artikel ans Herz gelegt. Interessant: Autor Peter Weibel, ein Medientheoretiker, deutet die inzwischen fast weltweit praktizierte Extrem-Kampfansage an das Virus auch als Versuch, „das Versagen ökonomischer und politischer Regime zu vertuschen, das trotz allen Signalen über Jahrzehnte hinweg verschleiert werden konnte, von den wiederkehrenden Finanz- und Migrationskrisen bis zur Pflege- und Klimakrise.“ Den kompletten Shutdown des Systems schließt er nicht aus. Hm ... herunterfahren, abschalten. Ist das nun gut oder schlecht? Was bleibt vom Guten, was geht vom Schlechten? Und umgekehrt? Humor und Angst, Tiefe und Triviales, Einmaleins und Exponentialrechnung, Tod und Leben – alles so dicht beieinander, kumuliert in meinem kleinen Kosmos der neuen Häuslichkeit.
Ende in Sicht?
Glücksmomente. Natürlich gibt es sie. Vielleicht abseits aller Verkopferei mehr oder tiefer denn je. Dankbarkeit, dass die Eltern gesund sind. Spieleeinheiten mit den Kindern. Gute Gespräche am regelmäßig - und nun oft vollzählig - besetzten Esstisch. Keksebacken ohne Weihnachtsstress. Kuschelzeiten am Abend. Lange Telefonate, die sonst im eng getakteten Alltag untergehen. Die Freundin, die mir ein indisches Curry vor die Tür stellt. Schokoladekuchen mit Vanilleeis – einfach so, wochentags zum Nachtisch. Satte Geborgenheit inmitten des Saustalls. Ein Momentum im Leben, aus der Fülle geboren, eingefroren. Stillstand, der Veränderung verheißt. „An Tagen wie diesen ...“ plärren die Toten Hosen aus den Lautsprechern im Zimmer meines Ältesten „... wünscht man sich Unendlichkeit“. Ich muss Campino widersprechen, ein Ende in Sicht wär‘ mir dennoch grad lieber. Aber das Wünschen und Wollen ist derzeit nicht im Angebot. Viel eher ist dies wohl die Stunde jenes Gebots, das wir so gerne bemühen, wenn’s auch mal um weniger geht: Das Gebot vom Loslassen und Annehmen. Übung macht den Meister. Toi toi toi.